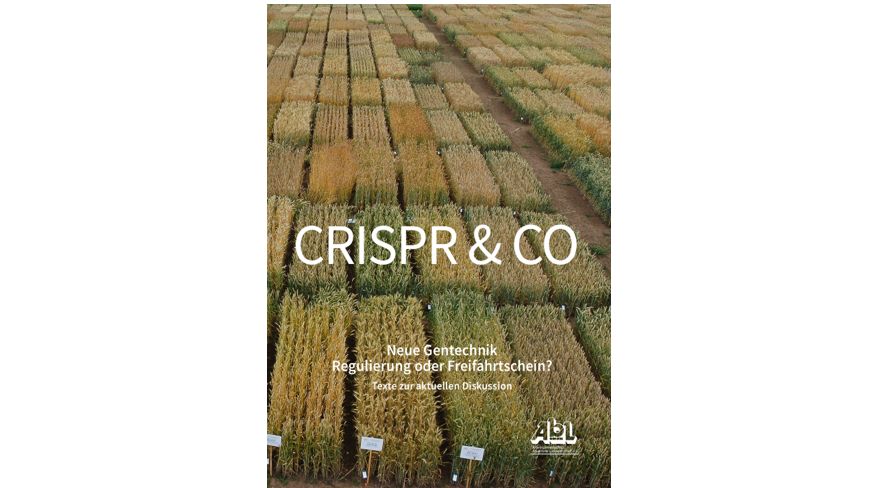Die EU-Kommission bereitet den Weg zur Deregulierung der neuen Gentechnikverfahren wie CRISPR & Co. Das ist ein Angriff auf die Gentechnikfreiheit Europas – diese gilt es mit vereinten Kräften zu verteidigen. Argumente aus Sicht der Betroffenen liefert eine neue AbL-Broschüre
Von Annemarie Volling
Ende April hat die EU-Kommission eine Stellungnahme zu neuen Gentechniken (NGT) veröffentlicht. Beauftragt wurde sie 2019 von den EU-Mitgliedstaaten, den „Status“ der neuen Gentechniken zu klären. 2018 stellte der Europäische Gerichthof (EuGH) klar, dass auch die durch NGT hergestellten Produkte als Gentechnik einzustufen sind und der EU-Gentechnik-Gesetzgebung unterliegen. Ein gutes Urteil für die gentechnikfreie Lebensmittelerzeugung. Gentechnik-Industrie und Forschungslobbyisten hingegen waren entsetzt und forderten eine Aufweichung der EU-Gentechnik-Gesetzgebung. Dieser Forderung ist die EU-Kommission nun einen Schritt entgegengekommen. Zwar bestätigt die Generaldirektion Gesundheit, dass CRISPR & Co Gentechnik sind, allerdings macht sie die Debatte auf, ob es noch zeitgemäß sei, sie auch nach dem geltenden Gentechnikrecht zu regulieren. Vorgeschlagen wird, dass nur noch Gentechnik Organismen, denen „artfremdes“ Erbgut eingebaut wurde (transgene Organismen), als Gentechnik reguliert werden sollen. Organismen an denen andere Veränderungen am Erbgut vorgenommen wurden (sog. SND-1, SDN-2, ODM und Cisgenese), sollten nicht mehr nach Gentechnikrecht reguliert werden. Als Begründung wird angeführt, dass diese Veränderungen des Genoms nicht unterscheidbar seien und dass das Risikopotenzial ähnlich einzustufen sei „wie bei Mutationen in der konventionellen Züchtung“. Für einige NGT´s und ihre Erzeugnisse seien die geltenden Gentechnik-Rechtsvorschriften „nicht zweckmäßig“ und müssten angepasst werden. Gleichzeitig nimmt die Kommission die Erzählung der Industrie auf: Neue Gentechnik hätte das Potenzial, zu einem nachhaltigen Lebensmittelsystem beizutragen, da schnell Pflanzen erzeugt werden würden, die widerstandsfähiger gegenüber Krankheiten, Umweltbedingungen und Auswirkungen des Klimawandels seien. Und NGT´s seien für viele Bereiche der Gesellschaft von Nutzen.
Wunschkonzert
Ob diese vollmundigen Versprechen, mit CRISPR & Co schnell „klimaanpassungsfähige“ und widerstandsfähige NGT-Pflanzen zu erzeugen eingelöst werden und ob diese dann auf dem Acker auch so funktionieren, ist im Moment sehr spekulativ. Es gibt kein Klimaanpassungs-Gen. Das Zusammenspiel der Gene ist hoch komplex und Pflanzen haben sehr unterschiedliche Reaktionsmöglichkeiten auf die verschiedenen Wetterentwicklungen. Die Kommission geht aber in ihrer Darstellung davon aus, als gäbe es solche und andere Pflanzen schon und als würden sie Beiträge zur Nachhaltigkeit leisten können. Unterschieden wird auch nicht, welche NGTs sich „in Forschung“ befinden und solche die „kommerzialisiert“ werden sollen.
Auch der diskutierte Vorschlag, bestimmte Anwendungen (SDN1, SDN2, ODM und Cisgenese) von der Regulierung auszunehmen, widerspricht der aktuellen Risikodebatte. Denn immer mehr Studien zeigen, dass es auch bei den vermeintlich „präziseren“ Gen-Scheren zu unerwarteten Effekten kommt, bspw. weil CRISPR an einem anderen Ort schneidet oder es durch die gewollte Veränderung zu nicht erwarteten Effekten kommt. Zudem können diese Verfahren mehrfach hintereinander oder in Kombination angewendet werden. Damit können sehr weitreichende Veränderungen vorgenommen werden – Auswirkungen unbekannt. Deshalb ist es wissenschaftlich geboten, alle neuen Gentechnik-Organismen einer verpflichtenden Risikoprüfung und einem Zulassungsverfahren zu unterziehen. Nur so kann das in der EU geltende Vorsorgeprinzip umgesetzt und das von der Kommission postulierte hohe Schutzniveau für Mensch und Umwelt eingehalten werden.
Regulierung schafft Rechtssicherheit und wirtschaftliche Vorteile
Neue Gentechnik ist Gentechnik und muss nach EU-Gentechnikrecht reguliert werden. Dies hat das richtungsweisende EuGH-Urteil vom Juli 2018 bestätigt und damit Rechtssicherheit für alle Wirtschaftsbeteiligten geschaffen. Regulieren heißt nicht verbieten, wie es zum Teil dargestellt wird, sondern beinhaltet die Verpflichtung zur Durchführung einer Risikobewertung und eines Zulassungsverfahrens. Sie bringt Anforderungen an Nachweisbarkeit, Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung der Gentechnik-Pflanzen und -Produkte mit sich. Für nicht in der EU zugelassene gentechnisch veränderte Organismen gilt Nulltoleranz. Freisetzungen zu Versuchszwecken unterliegen einem Genehmigungsvorbehalt. Es können Maßnahmen oder Verbote erlassen werden, um Risiken einzudämmen. Eine solche Regulierung der Gentechnik ermöglicht Transparenz, wo Gentechnik freigesetzt oder angebaut wird und Schutzmöglichkeiten vor Kontaminationen. Durch die Kennzeichnungspflicht wird Gentechnikfreiheit in der gesamten Lebensmittelerzeugungskette – von der Züchtung über den Anbau, Fütterung, Verarbeitung und Handel – ermöglicht. Rückverfolgbarkeit, Kontrollen und gegebenenfalls Rückrufaktionen können realisiert und Haftungsansprüche bei Verunreinigungen geltend gemacht werden. Das in der EU geltende Verursacherprinzip ist umsetzbar. Nur wenn das Gentechnikrecht auch auf neue Gentechnik angewendet wird, kann die gentechnikfreie Lebensmittelerzeugung auch in Zukunft sichergestellt und so die Wahlfreiheit für alle Beteiligten ermöglicht werden.
Wettbewerbsvorteil gentechnikfreie Landwirtschaft
Aktuell haben europäische Bäuer*innen einen großen Wettbewerbsvorteil, weil sie gentechnikfreie Pflanzen problemlos und meistens ohne Kontaminationsgefahren anbauen. Die abnehmende Hand verlangt Gentechnikfreiheit im Ackerbau, insbesondere die europäischen Mühlen, Verarbeitungsunternehmen und der Lebensmitteleinzelhandel. Selbst geringfügig verunreinigte Ware – unter dem gesetzlichen Grenzwert– sind enorm schwer zu verkaufen und führen zu entsprechenden Verlusten. Als darum gerungen wurde, den Gentechnik-Mais MON 810 Mitte der 2000er Jahre anzubauen, haben Bäuer*innen Gentechnikfreie Regionen gegründet, um ihre gentechnikfreie Erzeugung und die Vermarktung zu sichern. Ziel war, Berufskolleg*innen auf die Probleme des Anbaus von gv-Pflanzen hinzuweisen und von der Politik eine klare Sicherung ihrer Produktion zu fordern. Auch die Abnehmer*innen in Asien und Nordamerika verlangen gentechnikfreie Ware. Sollten die NGT-Pflanzen, wie von der Gentechnik-Industrie gefordert, dereguliert werden, könnten Bäuer*innen das Qualitätsmerkmal „gentechnikfrei“ nicht mehr erzeugen, sie würden zu austauschbaren Rohstofflieferanten und müssten zu noch schärferen Wettbewerbsbedingungen und Dumpingpreisen erzeugen. Weiteren Betrieben würde ihre Wirtschaftlichkeit und mittelfristig ihre Existenz entzogen. Auch tierische Produkte (Milch, Eier, Fleisch) „ohne Gentechnik“ erfreuen sich eines stetig wachsenden Marktes.[1] Entscheidend für Bäuer*innen ist, dass sie für ihre Mehrkosten durch die gentechnikfreie Fütterung den entsprechenden Aufschlag erhalten. Auch der Biomarkt, für den seine Verpflichtung, keine Gentechnik einzusetzen, ein wichtiges Verkaufsargument ist, boomt.
Viel zu verteidigen
Die EU-Gentechnikgesetzgebung basiert auf dem im EU-Recht verankerten Vorsorgeprinzip und der Wahlfreiheit. Auch die neuen Gentechnik-Verfahren sind risikobehaftet, ihr Nutzen für die Landwirtschaft fragwürdig. Entsprechend müssen sie aus Vorsorgegründen sowie zur Entwicklung einer zukunftsfähigen Landwirtschaft und Züchtungsarbeit wie auch aus wirtschaftlicher Sicht weiterhin nach EU-Gentechnikrecht reguliert werden. Es gilt das Recht auf gentechnikfreie Lebensmittelerzeugung und Wahlfreiheit zu sichern. Packen wir es gemeinsam an.
Annemarie Volling, Referentin für gentechnikfreie Landwirtschaft bei der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL)
Dieser Text enthält Auszüge aus der AbL-Broschüre: „CRISPR & Co. Neue Gentechnik – Regulierung oder Freifahrtschein?“ die als PDF oder Print zu beziehen ist: www.abl-ev.de/publikationen/
„CRISPR & Co. Neue Gentechnik. Regulierung oder Freifahrtschein?“ Die aktuelle Veröffentlichung der AbL gibt passende Antworten auf die nach der EU-Kommissions-Stellungnahme erneut an Fahrt gewinnende Debatte um eine mögliche Deregulierung neuer Gentechnik-Verfahren. Die Broschüre versammelt Perspektiven aus den unterschiedlichen Blickwinkeln derer, die in vielfältigster Weise von dem Thema berührt und betroffen sind. Zu Wort kommen Menschen aus Saatgutzüchtung, Landwirtschaft, Verarbeitung, Verbraucherschutz und den verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen (Molekulargenetik, Ökologie, Ethik, Recht). U.a. folgende Themen werden diskutiert: Wird CRISPR tatsächlich schnell und billig trockentolerante Pflanzen hervorbringen oder den Hunger besiegen? Was sagen die Entwicklungspipelines der Unternehmen? Wie bewerten Züchter*innen die neuen Verfahren? Was leistet bereits die konventionelle und ökologische gentechnikfreie Züchtung? Wie sind ethische Fragestellungen zu beantworten? Welche rechtlichen Aspekte gilt es zu diskutieren? Wie funktionieren die neuen Gentechniken? Welche Potenziale und welche Risiken bergen sie? Was wollen Verbraucher*innen? Können neue Gentechnik-Pflanzen nachgewiesen werden? Welche wirtschaftlichen Folgen hätte eine De-Regulierung der neuen Gentechniken? Zum Abschluss werden Forderungen aufgestellt, die aus bäuerlicher Sicht zur Sicherung der gentechnikfreien Lebensmittelerzeugung von Bedeutung sind. Die erkenntnisreiche Broschüre ist zu bestellen unter: www.bauernstimme.de/broschuere/ oder als PDF runterzuladen unter: www.abl-ev.de/publikationen/.
Dieser Text ist zuerst in der Zeitschrift “Wege für eine Bäuerliche Zukunft” Nr. 367, 2/2021 erschienen.
[1] Ende 2019 wurden nach Angaben des Verbandes Lebensmittel ohne Gentechnik 64 % der in Deutschland erzeugten Milch nach den „Ohne Gentechnik“-Kriterien erzeugt. Geflügelfleisch wird zu 60 %, (Schalen-) Eier zu 70 % „Ohne Gentechnik“ produziert.